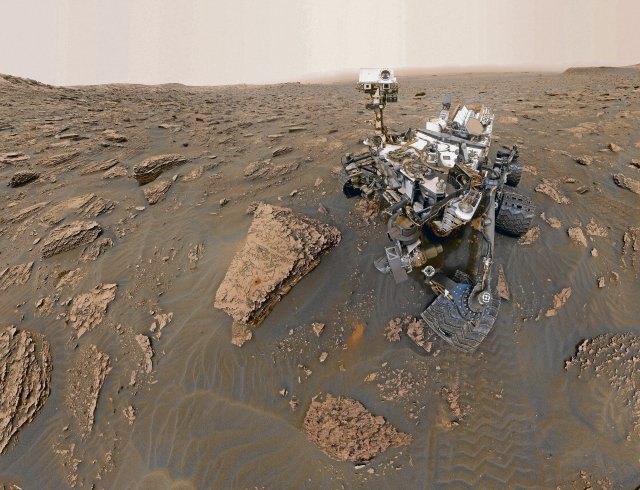Abschied von Schloss Camelot
Natalie Portman als »Jackie« Kennedy im Kino
Es ist der 22. November 1963: Diese Bilder sind der Zeitgeschichte eingebrannt, jedes Schulkind hat sie einmal in einem Zusammenschnitt über den Kalten Krieg gesehen, keine Fernsehdokumentation über die 1960er Jahre kommt ohne diesen einen Ausschnitt aus. Jacqueline Kennedy, 34 Jahre alt, sitzt in einem tadellos pinken Chanelkostüm neben ihrem Mann, dem 35. Präsidenten der USA, und klettert, nachdem ihn zwei Kugeln in den Kopf und Hals trafen, panisch zum Heck der Limousine, Hilfe suchend greift sie nach dem Secret-Service-Agenten, der dem Wagen hinterherläuft, da ist alles schon zu spät. Kühl und zackig ist der politische Übergang geregelt: Lyndon B. Johnson, von dem Kennedy nie viel hielt, wird noch auf dem Weg von Dallas zurück nach Washington in der Air Force One als neuer Präsident vereidigt. Die Öffentlichkeit aber hyperventiliert Tage, Wochen. Das Glamourpaar, »Jackie« und John F. Kennedy, hat dieser Augenblick zerstört. Zwei Menschen, so schön, so charismatisch, so kultiviert, dass dem Normalbürger nichts anderes übrig blieb, als sie zu bewundern, drapiert in diese sagenhafte höfische Aura des Weißen Hauses, »Jackies« und Johns Camelot.
Rund um den einen Tag im November dreht sich »Jackie« des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (»No«, »El Club«). Es ist nicht zu früh, an dieser Stelle schon zu behaupten, dass der Film das Genre Biopic wenn nicht revolutioniert, doch zumindest renoviert. Wie Larraín Close-ups kreiert, ist obszön. So nah möchte der Zuschauer der ehemaligen First Lady gar nicht kommen, ist in Trauer, Verzweiflung, Bitternis so dicht bei ihr, dass die feinen, mit teurem Puder bedeckten Gesichtshaare das halbe Bild einnehmen. Da blickt Jacqueline Kennedy (Natalie Portman), sekundenlang von uns beobachtet, in den Spiegel, das Gesicht vom Schmerz nicht verzerrt, sondern zur Maske geworden. Nur in den Augen ist zu sehen, was in ihr los ist. Das gar nicht mehr tadellose, blutverschmierte pinke Kostüm hat sie immer noch an, da ist sie längst wieder zurück im Weißen Haus. Auf einmal ist diese Frau, die für ihre Schönheit, ihre Noblesse verehrt wurde, der einsamste Mensch auf der Welt. Das Attentat, die Verschwörungstheorien, die sich darum ranken, das politische Vermächtnis Kennedys, das alles ignoriert Larraín. Keine Sekunde verschwendet er darauf, den Fokus von seiner Protagonistin zu lenken. (Es gibt tatsächlich keine Szene, in der sie nicht vorkommt.) »Jackie« ist keine konventionell verfilmte Aufsteiger-Absteiger-Biografie über eine berühmte, aber mysteriöse Frau, die von heute auf morgen ihre Privilegien, ihren Ruhm einbüßt, das ist, obwohl auf Jackie alle möglichen Interessen einprasseln, ein Kammerspiel. Es geht der bei aller verwischten Schminke immer ästhetisch in Szene gesetzten Witwe darum, ihrem Mann mehr Pferde, mehr Soldaten, mehr Kameras und mehr Tränen zu organisieren, als sie je ein verstorbener Präsident zuvor bekommen hat.
Den erzählerischen Rahmen bildet ein exklusives Interview, das ein namenloser Journalist (Billy Crudup) mit Jackie Kennedy nach der Ermordung ihres Ehemannes führte. Angelehnt sind die Szenen an ein stundenlanges Gespräch des Pulitzerpreisträgers Theodore H. White, das später auf nur zwei Seiten im Life-Magazin erschien. Jackie Kennedy war, und das zeigt Larraíns Interpretation, ein berechnender Mensch, darauf bedacht, das Erbe der Familie Kennedy - und vor allem ihr eigenes - gut poliert zu hinterlassen. Jackie Kennedy war die erste echte PR-Expertin des Weißen Hauses. Einerseits schildert Jackie dem Journalisten also in aller Eindringlichkeit, wie sie versucht, den Kopf Kennedys nach dem Schuss zusammenzuhalten, »damit alles drin bleibt«, nur um sofort anzuschließen: »Sie können vergessen, dass sie ein Wort davon veröffentlichen dürfen.« Gezeigt wird im Film dann tatsächlich, was da wo über der Karosserie verteilt war. Das ist den US-Amerikanern heute zuzumuten.
Und Natalie Portman gibt alles, sie zittert, sie fährt aus der Haut, als ihr erklärt wird, dass ihrem Mann eine Beerdigungsprozession, wie Lincoln sie bekam, aus Sicherheitsgründen versagt werden soll. Sie schweigt, sie donnert, sie wimmert und sie schluchzt. Sie macht deutlich, wie wichtig Augenbrauen sind (was ihr zu Recht eine Oscarnominierung einbrachte). Zu viel Zeit hat sie allerdings in das Nachahmen des unterwürfigen Tonfalls der echten Jacqueline Kennedy investiert, den die First Lady anknipste, sobald eine Kamera auf sie gerichtet war. Dazu Jackies Mid-Atlantic-Accent, der eine sehr eigenwillige Mischung aus dem amerikanischen und dem englischen Akzent ist, den Portman in der Annahme, es bis zur Perfektion treiben zu können, stattdessen bis an die Grenze zum Debilen verfremdet.
Larraín balanciert geschickt zwischen Entmystifizierung der Ikone Jackie Kennedy und der Konservierung ihres Images als Stilikone, deren Charisma bis heute nachwirkt. Melania Trump ist hierfür kein gutes, aber ein Beispiel. Was er gänzlich ignoriert, sind die boulevardesk ausgeschlachteten Skandale um die Ehe der Kennedys, das wäre eine Art vulgärer Voyeurismus, der dem Film sehr geschadet hätte. Subtil aber thematisiert Larraín Jackies schnellen Griff zu Tabletten, ihr Geltungsbedürfnis und den emotionalen Panzer, den sie sich als eine Frau der 1960er Jahre zulegen musste, die den Mief von Truman und Eisenhower aus dem Weißen Haus vertreiben wollte.
Nur ein sarkastischer Satz, kurz bevor sie aus dem Flugzeug in Dallas steigt, muss reichen (»Ich liebe Menschenmassen«), um die Panik abzubilden, die sie vor der Öffentlichkeit entwickelte. Der Fokus, den Larraín gewählt hat, Jackies fast wahnhaftes Streben nach Heiligsprechung der Familie, in dem sie die einzige Möglichkeit sah, selbst mit erhobenem Haupt weiterleben zu können, ist dennoch ein enges Korsett, in das er seine Protagonistin steckt. Nichts, so hat es Jacqueline Bouvier einmal ins Jahrbuch ihrer Abschlussklasse geschrieben, fürchtete sie mehr, denn als Hausfrau zu enden. Diese Angst, die sie ihr Leben lang antrieb, deutet der Ausschnitt, den Larraín gewählt hat, nur an. Was bleibt, ist der verbissene Kampf einer Frau, die ihrem eigenen Camelot-Mythos verfallen war.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.